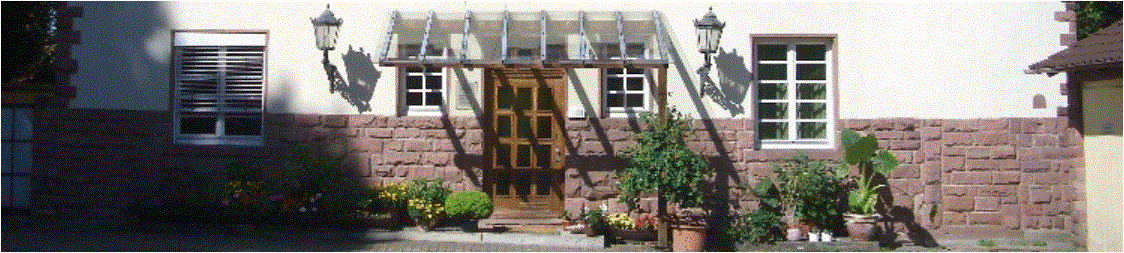Stand der Forschung
Angesichts der Breite der beteiligten Disziplinen kann im Folgenden der Forschungsstand nur in exemplarischen Ausschnitten präsentiert werden. Das Ideal der Selbstverwirklichung muss im Kontext der Individualisierungsprozesse moderner westlicher Gesellschaften situiert werden, die vor allem seit den achtziger Jahren in den Vordergrund soziologischer und ideengeschichtlicher Forschung gerückt sind (Beck 1986, Taylor 1989, Giddens 1991, Joas 1992, Schulze 1992, Beck/Beck-Gernsheim 1994). Mittlerweile ist auch die soziologiegeschichtliche Dimension dieses Themas aufgearbeitet worden (Schroer 2001). Die zumeist nicht terminologisch präzise Verwendung des Begriffs der Selbstverwirklichung ist problemgeschichtlich rekonstruiert worden (Gerhardt 1989). Systematische Bemühungen um eine Begriffsbestimmung von Selbstverwirklichung werden überwiegend im Diskurszusammenhang der Ethik des guten Lebens unternommen, und zwar entweder unter aktualisierendem Rückbezug auf den antiken Eudämonismus (Norton 1976) oder auf romantische und existenzphilosophische Interpretationen menschlicher Individualität (Theunissen 1982; Menke 2005) oder auch in ausdrücklicher Profilierung einer modernen, nachmetaphysisch desubstanzialisierten Konzeptualisierung der Selbstverwirklichung gegenüber solchen historischen Bezügen (Kambartel 1989; Krämer 1998; Schlette 2012, 2013). Auch im gegenwärtigen sozialtheoretischen Diskurs zur Geschichte und zu den Entfaltungsbedingungen moderner individualisierter Gesellschaften spielt der Begriff der Selbstverwirklichung eine Rolle (Honneth 2011). Eine weitere Strategie seiner Bestimmung besteht darin, Merkmale faktisch misslingender Lebensführung zu benennen, von denen wir sicher sind, dass sie insbesondere dem Anspruch der Selbstverwirklichung widersprechen (Jaeggi 2005). Damit hängt die Untersuchung systemischer Vereinnahmungen des Selbstverwirklichungsideals zusammen, die den Einzelnen mit einem sozialen Druck konfrontieren, dem entsprechenden Charakterprofil zu genügen (Honneth 2002; Kocyba 2005). Die Verknüpfung der Selbstverwirklichungsthematik mit Fragestellungen eines gelingenden Lebens im Alter ist nach wie vor ein Desiderat (vgl. Schlette 2010).
Im Zusammenhang mit dem sozialen Deutungsmuster der Selbstverwirklichung und den damit verbundenen impliziten und expliziten Verhaltenserwartungen ist auch die produktivistische Neuverhandlung des Alters zu sehen, die derzeit in aller Munde ist und die sozialgerontologischen und alter(n)swissenschaftlichen Arbeiten sowohl in affirmativer wie kritischer Hinsicht prägt. Im deutschsprachigen Raum sind die kritischen Stimmen vergleichsweise leise, und es dominiert gerontologisch, politisch und medial die Perspektive einer „win-win“-Konstellation des aktiven und produktiven Alters (van Dyk et al. 2010): Das produktive Alter komme, so die verbreitete Annahme, allen Seiten zugute: Der Gesellschaft werden gemeinwohldienliche Ressourcen erschlossen, den Älteren Verwirklichung ihrer selbst und Teilhabe in Aussicht gestellt. Was ökonomisch – unter Verweis auf den demographischen Wandel und dessen Folgewirkungen – als notwendig deklariert wird, scheint somit zugleich auch ethisch geboten: Entworfen wird damit eine Welt, in der sich Aktivität/Produktivität auf der einen sowie Selbstverwirklichung/Anerkennung älterer Menschen auf der anderen Seite miteinander verbinden. Mögliche Friktionen zwischen Selbstverwirklichung und Ressourcennutzung sind aus dieser Perspektive konzeptionell nahezu ausgeschlossen. In der angelsächsischen Diskussion korrespondiert der win-win-Perspektive eine Kritik des Produktivitätsparadigmas, die – gleichwohl mit umgekehrten Vorzeichen – ebenfalls dazu tendiert, Ambivalenzen und Friktionen auszusparen: Häufig theoretisch inspiriert durch die an den späten Michel Foucault anschließenden Gouvernementalitätsstudien, werden Diskurse des produktiven Alters v.a. hinsichtlich ihrer normierenden und disziplinierenden Wirkung problematisiert (z.B. Rudman 2006). Die Frage der mit dem verbreiteten Plastizitätsversprechen einhergehenden Gestaltungsoptionen in einer Phase des Abbaus und Verfalls bleibt in kritischen Analysen hingegen allzu häufig unterbelichtet.
Eine Auseinandersetzung mit den sich im Schnittfeld von Neurowissenschaften, Vorsorge-, Bildungs- und Altersdiskurs entwickelnden Individualitätskonzepten ist zunächst auf die rasanten Fortschritte der Neurowissenschaften verwiesen. Die Neurowissenschaften als rapide wachsendes Forschungsfeld eröffnen faszinierende Möglichkeiten für Forschung, Diagnose, Therapie und andere Anwendungen. In letzter Zeit haben besonders Studien zu neuronaler PlastizitätFragen über Entwicklung, Lernen, Pathologien, Effekte psychoaktiver Substanzen, und kortikaler Stimulation erhellt. Die Plastizität des Gehirns ist die Fähigkeit des Organs, auf Erfahrungen mit Veränderungen in neuronaler Aktivität, Struktur und Funktion zu reagieren. Alltägliche Erfahrungen und zielgerichtete Interventionen hinterlassen ihre Spuren im Gehirn. Plastizität geschieht auf vielen Zeitskalen, auf ganz verschiedenen räumlichen Niveaus und wird je nach Untersuchungsmethode unterschiedlich beschrieben (Buonomano et al. 1998, Pascual-Leone et al. 2005). Ein zentraler Befund ist, dass Plastizität allgegenwärtig ist (Jäncke 2009). Sie ist die natürliche Konsequenz neuronaler Aktivität jeglichen Ursprungs. Entgegen vorheriger Annahmen lässt sich die Veränderbarkeit des Gehirns nicht nur im Kindesalter, sondern in allen Lebensphasen nachweisen (Dinse 2006, Elbert et al. 1995, Draganski et al. 2006). Auch im Alter sind plastische Prozesse zu beobachten, die sich durch gezielte Maßnahmen auch fördern lassen. Die Möglichkeiten, die sich für Beeinflussungen des Gehirns ergeben, sind enorm. Das hat Auswirkungen auf den selbstbestimmten Umgang mit den eigenen geistigen Zuständen und Leistungen (Malabou 2006, Nagel 2013). Es ist zu untersuchen, wie unser zunehmendes Wissen über die Veränderbarkeit des Gehirns unser Verständnis von Autonomie und Verantwortlichkeit beeinflusst. Die Präsenz der Techniken zur Selbstgestaltung geht einher mit zunehmender Verantwortlichkeit. Die Neurowissenschaften schaffen Handlungswissen und damit einhergehend auch Präventionswissen. Es liegt nahe anzunehmen, dass unsere persönliche Geschichte, unsere Individualität, und unser individuelles Altern mehr durch unser eigenes Verhalten beeinflussbar ist, als wir es bis jetzt angenommen haben. Diese Erkenntnisse erfordern eine Diskussion ihrer Konsequenzen für das individuelle und soziale Leben.
Die Forschungsergebnisse der Neurowissenschaften und ihre Popularisierung fügen sich ein in einen Diskurs über Gesundheitsvorsorge, der zunehmend den Alltag prägt. Unser Alltag wird von kaum einem anderen Thema so sehr durchdrungen wie von dem der Gesundheit. Nahezu alle gesellschaftlichen Sphären rekurrieren auf die eine oder andere Weise auf diesen Wert. Illona Kickbusch spricht daher von Gesundheit als einem „Megatrend“, der die Gesellschaft als Ganzes erfasst (Kickbusch 2006). Die von ihr ausformulierten vier Maximen der „Gesundheitsgesellschaft“ – „Gesundheit ist grenzenlos, Gesundheit ist überall, Gesundheit ist machbar, und jede Entscheidung ist zugleich immer auch eine Gesundheitsentscheidung“ (ebd.: 10) – bilden einen allumfassenden Rahmen für unsere Alltagswelt. So wird Gesundheit heute zu einem generalisierten Code, der „völlig disparate Bereiche des menschlichen Lebens und Arbeitens (z.B. Führungsstile, Unternehmen, Nutzung von Berufskleidung, Spaß an der Arbeit, Ernährung, Beziehungsgestaltung) unter ein Label fasst und in einem Deutungsfeld vereint“ (Brunnett 2008: 77). Mit der Ausweitung des Gesundheitsdiskurses auf viele unterschiedliche Lebensbereiche ist auch eine zunehmende Individualisierung und Verantwortungsübertragung auf den Einzelnen verbunden. Sie steht für die zunehmende Verpflichtung Einzelner und Familien, ihre eigene Gesundheit zu überwachen und zu managen. Gerade in Bezug auf das Alter offenbaren hier präventive Gesundheitspraktiken ihren hegemonialen (vgl. Brunnett 2008) und normierenden (vgl. Schroeter 2009) Charakter. So wird aus der „dritten Lebensphase“ (Kohli 1985), die vormals dem Kontemplativen vorbehalten blieb, das “dritte Alter“ ungebrochener Aktivitätsorientierung (Rowe/Kahn 1987/1998, Baltes/Carstensen 1996), das sich vom „vierten Alter“ mit seiner körperlichen Hinfälligkeit und Multimorbidität idealtypisch unterscheidet. Auch die Älteren sollen Jugendlichkeit und Leistungsfähigkeit präsentieren (Katz 2000; Marshall 2012). Dazu gehört selbstverständlich die Abwesenheit von Krankheit und eine ausreichende Fitness (Higgs et al. 2009).
Besonders dramatisch stellt sich das Problem einer Anpassung an die Aktivitätserwartungen in der Phase des Übergangs in das ‚vierte Alter‘ dar. In keiner anderen Altersgruppe ist das Spannungsfeld zwischen Selbstverwirklichung und Depotenzierung so ausgeprägt wie in dieser Gruppe. Die systematische Hundertjährigen-Forschung hat aber gezeigt, dass auch in dieser Lebensphase Handlungsspielräume selbstbestimmten Umgangs mit dem Altern vorhanden sind (vgl. die Heidelberger 100-Jährigen-Studie). Sie werden aufgrund der Unbeständigkeit der menschlichen Architektur für ein sehr langes Leben aber immer kleiner. Der biologische Druck steigt an. So sind körperliche und kognitive Gebrechen sichtbar und leicht zu erkennen, hiervon unbeeinträchtigte Elemente im Leben der Hochaltrigen existieren eher im Verborgenen. Nach ihnen wird in der Regel auch gar nicht gesucht. Wir wissen nahezu nichts über subjektiv bedeutsame Ziele und deren Verfolgung, und wie Hochaltrige mit den oftmals großen Einschränkungen zurechtkommen. Systematische Forschungen sind selten, offenbaren aber deutliche Anzeichen eines Individualismus der Selbstbewahrungskompetenz, der sich in psychologischen Stärken manifestiert. In den Heidelberger 100-Jährigen-Studien zeigt sich auch ein Wandel der Generationenbeziehungen. Waren die Kinder der Hundertjährigen in der ersten Studie stolz, dass ein Elternteil die magische Grenze von 100 Jahren überschritten hat, werden in der Folgestudie 10 Jahre später die großen Belastungen der Versorgung deutlich thematisiert, insbesondere wenn kognitive Einschränkungen und Demenzen vorhanden sind. Es wäre also aus unterschiedlichen Perspektiven zu diskutieren, inwiefern in diesem Alter überhaupt noch ein Anspruch sozialer Produktivität besteht bzw. bestehen kann, was für Hochaltrige und Hundertjährige Selbstverwirklichung bei in der Regel eingeschränkten körperlichen und geistigen Ressourcen bedeutet, inwieweit eine systematische Selbstsorge für diese Lebensphase überhaupt möglich ist und wie sich die Beziehung zu den bereits alten oder sogar sehr alten Kindern gestaltet.
Lernprozesse erhalten in den späten Lebensphasen aufgrund ihrer altersspezifischen Charakteristiken wachsende Bedeutung, wenn der Anspruch der Selbstverwirklichung nicht aufgegeben werden soll. Bildungsbemühungen zielen darauf ab, die Seniorinnen und Senioren einerseits zur gesellschaftlichen Teilhabe und Mitgestaltung zu befähigen, während das Gemeinwesen andererseits auf ihr freiwilliges Engagement und Erfahrungswissen im sozialen, kulturellen, kirchlichen und pflegerischen Bereich angewiesen ist. Selbstverwirklichungsprozesse und die Suche nach sinnstiftenden Verantwortungsrollen in der nachberuflichen bzw. nacherzieherischen Phase sind in sozialräumliche Kontexte eingebunden. In den drei Freiwilligensurveys (1999, 2004, 2009), wonach ein Drittel der 65- bis 74-Jährigen in Deutschland mindestens eine ehrenamtliche Tätigkeit übernimmt, bildet sich indessen die Grundproblematik der sozialen Ungleichheit ab: Die Bereitschaft zum bürgerschaftlichen Engagement, d. h. zu einem ‚produktiven‘ und ‚aktiven‘ Altern, steigt mit dem Umfang des lebensgeschichtlich erworbenen ökonomischen, sozialen und kulturellen Kapitals. Mit dem Ausmaß dieser zur Verfügung stehenden Ressourcen korreliert ebenfalls das subjektive Gesundheitsempfinden, die Lebenszufriedenheit sowie die Fähigkeit, mit Verlusten, Krankheiten wie physisch-psychischen Depotenzierungsprozessen umzugehen und sie zu kompensieren. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich als erstes Forschungsdesiderat, milieuspezifische Zugänge zum ‚lebenslangen Lernen‘, zur Gesundheitsvorsorge und zur Altersproduktivität zu erkunden und Strategien zur Überwindung von Bildungsbarrieren zu erarbeiten. Des Weiteren gilt es – im Kontrast zur Dichotomisierung eines leistungsfähigen Dritten Lebensalters und eines hinfälligen Vierten Lebensalters –, stärker Lernprozesse bei Hochaltrigen sowie bei älteren Menschen mit körperlich-geistigen Beeinträchtigungen in den Blick zu nehmen. Beispielsweise zeigt die aktuelle Demenzforschung Lerneffekte von Spiel, Musik, Bewegung und Gedächtnistraining auf. Aus geriatrischer Perspektive sind drittens die Potenziale und die Lernerfordernisse von altersgerechten Assistenzsystemen für ein gesundes und autonomes Leben (ambient assisted living) im Schnittbereich von neuen Technologien und sozialem Umfeld zu reflektieren (Nagel/Remmers 2012). Schließlich und viertens weisen Forschungen zur Salutogenese im Anschluss an Aaron Antonovsky sowie zu Kenneth Pargaments Krisenbewältigungsstilen (Coping) auf ein weiteres, in der deutschsprachigen Gerontologie bislang unzulänglich erforschtes Feld hin: die Bedeutung von Sinnstiftung, Spiritualität und Religiosität für ein ‚gesundes‘, selbstbestimmtes Altern.
In der Theologie hat das Thema „Alter“ in den vergangenen Jahren einen prominenten Stellenwert erhalten (Kumlehn/Kubik 2012; Kumlehn/Klie 2009; Rieger 2008). Dabei sind jüngst auch Themen der Prädiktion und Prävention in den Blick gekommen (vgl. Kumlehn/Klie 2009). Hier werden ansatzweise kulturwissenschaftliche, sozialwissenschaftliche und medizinhistorische Gesichtspunkte einbezogen. Allerdings steht die Auseinandersetzung mit der Medizingeschichte, der Medizinanthropologie und den übrigen mit den Themen Medizin, Krankheit, Prävention befassten Sozialwissenschaften in der Theologie erst am Anfang (vgl. Moos et al. 2011). Dies erscheint um so erstaunlicher, als das Thema Krankheit und Heilung in der Geschichte des Christentums eine große Rolle spielt und das für die Selbstverwirklichung im Alter fundamentale Spannungsfeld von Freiheit und Angewiesenheit zu den Kernthemen der Theologie gehört. Man hat hier von einem „Krankheitsschweigen“ der systematischen Theologie gesprochen (vgl. Etzelmüller/Weißenrieder 2010). Auch das Thema der Neurowissenschaften hat bisher wenig Rückhalt im theologischen Fachdiskurs (vgl. aus der Au 2011). Für die Theologie besteht also das erhebliche Forschungsdesiderat, die systematisch- und praktisch-theologische Reflexion des Alters und der Selbstverwirklichung alter Menschen empirisch anzureichern und in der Folge auch systematisch zu schärfen. Insofern die Theologie sich der lebensphasenspezifischen Hermeneutik gelebter Religion widmet, ist sie gleichwohl für die Rekonstruktion von Bewährungsaufgaben im Alter eine wichtige Gesprächspartnerin. Sind es doch gerade die Momente der Endlichkeit, des Verfalls, des Selbstabbaus einerseits, der Selbststeigerung und Selbstvollendung andererseits, die im Symbolkosmos des Christentums ihren Niederschlag gefunden haben. In den sich verändernden Ausdrucksgestalten der Religiosität alter(nder) Menschen spiegeln sich, so die hier zugrunde gelegte These, die sich verändernden Bewährungsaufgaben und Individualisierungskonzepte des Alters. Hier eröffnet sich ein weites Forschungsfeld.